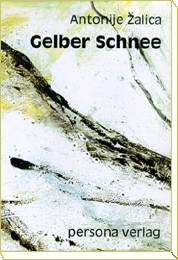
Roman
2001
234 S. Hardcover
D: € 17,00, A: € 17,50, SFR 31,50
3-924652-29-5
Antonije Zalica
Gelber Schnee
Aus dem Serbokroatischen von Astrid Philippsen Nachwort Svetlana Slapsak
Gelber Schnee: Sarajevo 1992: Wie der Wind aus der Sahara feinen Sand
herbeiwehte, der den Schnee auf den umliegenden Bergen gelb färbt, so
sieht auch in Sarajevo plötzlich alles anders aus. Die Bevölkerung
versucht zunächst weiterzuleben wie bisher. Der Erzähler geht am
Wochenende mit der "multikulturellen" Freundesclique zum Skilaufen und
Tennisspielen; sein Bruder, ein Bühnenregisseur, ist mit der
Inszenierung von "Romeo und Julia" beschäftigt. Auch der Erzähler ist
an dieser Produktion beteiligt. Das Stück soll in atemberaubendem Tempo
inszeniert werden, doch "Romeos Rhythmus" wird zum Rhythmus ihres
eigenen Lebens im Krieg. "Das ganze Leben wurde zurückgeführt auf vier
Grundelemente (Feuer, Wasser, Erde, Luft)."
Zalica beschreibt auf anrührende, assoziative Weise, wie der Erzähler und seine
Generation sich in der belagerten Stadt zu behaupten versuchen. In der Isolation
der Luftschutzkeller bleibt die Einheit der Völker erhalten, ungeachtet dessen,
was "draußen" passiert: Kroaten, Serben und Muslime teilen darin Liebe und Leid.
"Der Nationalismus kam uns damals lächerlich vor, wir kannten ihn nur aus
Witzen."
Die Schrecken des Krieges werden in erster Linie indirekt, "durch die Augen der
anderen", präsentiert und in leicht ironischem, ja humorvollem Erzählstil
wiedergegeben.
Es ist auch ein Buch über veränderte Wahrnehmung, denn der Engel
auf der Schulter des Erzählers verleiht ihm einen siebten Sinn.
Astrid Philippsen studierte Slawistik in Berlin und Belgrad. 1966-1972 war sie
Lektorin beim Aufbau-Verlag, seitdem freie Übersetzerin u.a. der Werke von
Dragan Velikic und Slavenka Drakulic. Für ihre literarischen Übersetzungen
wurde sie 2000 mit dem Paul-Celan-Preis ausgezeichnet.
Svetlana Slapsak stammt aus Belgrad und ist eine Kennerin der intellektuellen
Szene des ehemaligen Jugoslawien und des Exils. Die Kulturwissenschaftlerin mit
Schwerpunkt Alte Geschichte erhielt zahlreiche Auszeichnungen und wirkte als
Gastprofessorin in Europa und Übersee. Neben ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit
war sie stets eine streitbare Journalistin und politische Aktivistin, was zu
erheblichen Brüchen in ihrer Karriere führte. Sie hat sich schreibend und
edierend mit dem politischen Exil unserer Zeit auseinandergesetzt und arbeitet
zur Zeit an einem Roman über Frauen im bombardierten Belgrad und im Exil. Nach
einem Forschungsaufenthalt am Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte
in Berlin lebt sie derzeit in Ljubljana.
Buchentstehung
Die Originalausgabe erschien 1995 im Verlag des unabhängigen Belgrader Senders
Radio B92 unter dem Titel ‘Trag zmajeve sape’ -- ‘Die Spur der Drachenpranke’.
So hießen im Volksmund die Spuren der Granateinschläge. Nach der polnischen
und niederländischen Ausgabe war dies die dritte Übersetzung in eine fremde
Sprache. Hazel Rosenstrauch hatte den Autor bei einer Tagung kennen gelernt und erzählte
mir, er hätte ein Buch geschrieben ...

Zum Autor
Sarajevo 1959: Antonije Zalica kommt in einer Theater- und Dichterfamilie zur Welt. Er studiert Vergleichende Literaturwissenschaft und Philosophie, schreibt für Rundfunk, Fernsehen und Bühne, veröffentlicht Gedichte und Kurzgeschichten und dreht Dokumentarfilme. 1992 ist Zalica Dramaturg am Theater und Programmanager beim Fernsehen. Seine vielversprechende Karriere wird wie das Theater und die Fernsehstationen vom Krieg zerstört. Er beteiligt sich an den Projekten von SAGA, einer Künstlervereinigung, die mitten im Krieg ein reduziertes Kulturprogramm aufrecht erhält, und dreht Dokumentarfilme. Amsterdam 1993: Ankunft in einem fremden Land. Zalica kann seine Film-, Theater- und Literaturarbeiten fortsetzen. Er ist Gastdozent an der Film- und Fernsehakademie Hilversum, seine Filme werden auf Festivals mit Preisen ausgezeichnet und seine literarischen Texte ins Niederländische übersetzt. Zalica verweigert sich jeder nationalen Schublade. Sein Familienhintergrund sei “österreichisch-ungarisch-tschechisch-montenegrinisch”. Früher habe er Serbokroatisch geschrieben, heute “Serbisch, Kroatisch, Bosnisch -- Balkan-Jiddisch eben”.
Pressestimmen
"Der Roman versagt sich jedes ‘Styling’ in Form und Sprache. Er kennt Ironie und Rhythmus, Metapher und Dialogführung. Aber er steht im Dienste von Menschen, und die haben Namen. Diese Namen klingen für uns fremd, aber der Autor stellt sie uns selbst dann noch vor, wenn er nur noch von ihrem Tod berichten kann. Sie kommen als unterschiedliche Menschen zu Wort und Ehren...Neben Dubravka Ugresic und Bora Cosic ist Antonije Zalica der dritte bedeutende jugolsawische Exilschriftsteller, der seine literarische Stimme gegen den Nationalismus und für die Menschen erhebt. Ein wichtiges Buch!" (Harald Loch, Mannheimer Morgen)
Textprobe
"Während ich eilig die Treppe hinunterging, betete ich ein Vaterunser und dann ein Ave Maria (genau so viel Zeit brauchte ich vom fünften Stockwerk bis zum Erdgeschoss), und wenn ich dann unten am Ende des Treppenhauses ankam und mich nur noch ein paar Meter Hausflur von der Straße trennten, blieb ich stehen, meist auf der zweiten oder dritten Stufe, und hielt mich am Geländer fest (wenn jemand käme, sähe es so aus, als hätte ich in der Wohnung etwas vergessen und sei am Überlegen). Dann wartete ich auf die Stimme des Engels und ganz gleich, wie wichtig die Sache war, die ich vorhatte, ob etwas sein "musste", selbst wenn ich versprochen hatte irgendwohin zu kommen, oder abgesehen von dem Trieb, der mich nach draußen zog - wenn ich nur ahnte, dass er "nein" sagen oder zögern würde, kehrte ich um. Wenn ich schon auf der Straße war, ließ ich meinen Engel den Weg wählen, und manchmal machte ich lange Umwege, schlich mich durch Hinterhöfe und Passagen, doch gehorchte ich stets. Ob er wohl immer Recht hatte? Ich weiß es nicht, ich habe nie versucht ihn auf die Probe zu stellen, und also lebe ich, hier und jetzt, und das will schon etwas heißen! Nur wenn ich in die Akademie für Bühnenkunst ging, um Brot zu backen, fragte ich den Engel nichts. Ich blieb nicht auf der dritten Stufe stehen, sondern bat ihn nur, mich zu beschützen, stürzte nach draußen, über die Straße, über die Brücke, hinten herum durch den Hof und - direkt hinein in die Akademie. Zu Hause waren mein zweijähriger Sohn und meine schwangere Frau, sie mussten essen. Dort in der Akademie gab es einen Ofen und als Brennmaterial verwendeten wir die Kulissen vom Theater. Als Erste musste die Kahle Sängerin dran glauben und dann verheizten wir die Holzrahmen und Requisiten einer Vorstellung, die Der Turm zu Babel hieß. In der Akademie lebten zu der Zeit ziemlich viele Leute. Im gleichen Raum war auch die Galerie Obala, d.h. Ufer, untergebracht. Da waren der Leiter der Galerie und seine Frau, eine Malerin, mehrere Schauspielstudenten, ein Bühnenarbeiter mit Frau und Kind, etliche versteckten sich vor der Einberufung, eine alte Frau, mehrere Flüchtlinge aus Grbavica und ein Regiestudent. Sie hatten sich gut eingerichtet und es war auch nicht langweilig. Jeden Tag kamen welche von uns, um Brot zu backen oder Reis zu kochen. Außer mir kam da noch die Schauspielerin Milijana mit ihrem Freund oder Mann, ich weiß nicht mehr, ein Architekt und ein Rock-Gitarrist. Ab und zu versammelten sich noch eine Menge mehr Leute dort, und manchmal konnte es sehr fröhlich zugehen. Eine Etage höher befanden sich die Pädagogische Akademie und ein verlassenes Chemielabor. Einmal gab ich zum Besten, wie wir beim Fernsehen den ganzen Alkohol ausgetrunken hatten, der zur Reinigung der Video-Köpfe bestimmt war..."