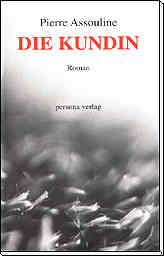
Roman
1999
208 Seiten, Hardcover
D: € 17,00, A: € 17,50, SFR 31,50
ISBN 3-924652-28-7X
Pierre Assouline
Die Kundin
Aus dem Französischen von Marianne Schönbach
Bei Recherchen zum Leben des Schriftstellers Desiré Simon im besetzten Paris stößt der Erzähler auf anonyme Denunziationen aus dem Jahr 1941. Er blättert und stockt, als er einen Namen entdeckt, der ihm vertraut ist: Familie Fechner gehört zu seiner angeheirateten Verwandtschaft und betreibt nach wie vor ein Kürschnergeschäft im 15. Bezirk von Paris. Diese Denunziation läßt ihn nicht los. Er erwirkt die Erlaubnis, aus den Polizeiakten den Namen der Denunziantin einzusehen. Es handelt sich um eine "anständige Bürgerin": Cécile Armand-Cavelli, die fast die gesamte Familie Fechner in den Tod geschickt hat, ist Floristin und seit Jahr und Tag Inhaberin eines Blumengeschäfts direkt gegenüber der Fechnerschen Kürschnerei. Der Erzähler weiß, daß die Fechners dort ihre Blumen kaufen und daß sie ihrerseits den Fechners ihre Pelze zum Aufarbeiten bringt.
Soll er den Fechners von seiner Entdeckung berichten? Den Fechners, die nie über die Zeit der Verfolgung sprachen? Warum hat die Floristin sie denunziert?
Er kommt den Dingen auf die Spur, konfrontiert Cécile Armand-Cavelli mit ihrer Vergangenheit, und macht schließlich eine Entdeckung, die seine Besessenheit, diesen Verrat aufzuklären und die Wurzeln des Bösen bloßzulegen, erschüttert. Die Geschichte nimmt ein unvorhergesehenes, dramatisches Ende, das der Erzähler zu verantworten hat.
Auch als Hörbuch, gelesen von Boris Mattèrn: www.hoerkultur.com
Buchentstehung
'Die Kundin' ('La Cliente') erschien 1998 bei Gallimard. Es war die fünfzehnte Publikation Pierre Assoulines und sein erster Roman. Mich hatte die übersetzerin Marianne Schönbach darauf aufmerksam gemacht.

Zum Autor
Pierre Assouline wurde 1953 in Casablanca geboren. Er entstammt einer sephardischen Familie, sein Vater kämpfte in der Résistance. Assouline ist Redaktionschef der Zeitschrift "Lire". Er schrieb Biographien, z. B. über Georges Simenon, Jean Jardin, Hergé, Gaston Gallimard, Daniel-Henry Kahnweiler, und Dokumentationen z. B. über Lourdes und "Le dernier des Camondo" über eine legendäre sephardische Bankiersdynastie. Seine Bücher wurden in mehrere Sprachen übersetzt. "In meinen Augen ist das Leben nicht schwarz-weiß", sagt Pierre Assouline. "Es ist grau. Was mich interessiert, sind die Menschen und ihre geheimen Schubladen."
Pressestimmen
"Ein großartiger Roman und eine Lehre ... Atmosphäre á la Maigret ... Die Geschichte eines schrecklichen Verrats: Ein authentischer Fall von Denunziation, der eine jüdische Familie während der deutschen Besatzungszeit zum Opfer fiel, inspirierte Pierre Assouline zu einem sensibel geschriebenen und dennoch packenden Roman, der den Leser bis zum überraschenden Ende der Story nicht mehr loslässt." (Le Figaro)
"Wer sich nie an das Thema Judenverfolgung traute, der sollte Die Kundin lesen. Pierre Assouline erzählt die Geschichte eines Archivfundes, der unter die Haut geht, mit einer Pointe, die keinen ungeschoren davonkommen läßt." (Petra Rupp, Buchmarkt)
Textprobe
"Den Ordnungssinn und die Strenge des typischen Beamten kann man gar nicht genug rühmen. Mein systematisches Suchen führte mich bald zu anderen Kartons, deren Existenz ich nicht einmal vermutet hatte: Vor mir hatte ich die Akten der provisorischen Verwaltung arisierter Unternehmen. Immer enger zog sich die Schlinge zu. Arisiert ... Ich wunderte mich nicht einmal mehr über dieses Wort aus einer anderen Zeit, vergaß, wie häßlich es eigentlich ist. Es ließ mich nicht mehr los. Arisiert, arisiert, a-ri-siert! Als mein Tischnachbar sich zu mir umdrehte und mich anstarrte, merkte ich, daß ich wieder einmal laut gedacht hatte. So hätte er auch jemanden angesehen, der sich im Delirium befindet. Ich stieß gegen die Mauern einer Welt, deren Zeichen nicht die meinen waren. Um nichts in der Welt hätte ich ihre Wörter haben mögen. Ich las sie im übrigen so, wie man Texte in einer fremden Sprache liest. Nur weil ich sie bewahren wollte, schrieb ich sie auf. Um sie wie ein gewissenhafter Insektenforscher besser unter dem Mikroskop untersuchen zu können. Dennoch hatte ich nur einen Wunsch: sie möglichst bald wieder loszuwerden, aus Furcht, daß sie sich in meinem Heft niederlassen, dort Wurzeln schlagen, sich entfalten, ein Geschlecht begründen, sich vermehren würden - der absolute Horror. Arisiert ... Hier begegneten mir die Namen von Bekannten und Geschäftsleuten, die mir aus meinem eigenen Alltag vertraut waren. Der Besitzer des Restaurants Dominique, der Geschäftsführer des Zirkus Amar, einer der Verwalter des Kaufhauses Old England, der Augenoptiker Lissac, der sich gezwungen sah, seiner Kundschaft mitzuteilen, er heiße nicht Isaak, und viele andere mehr ... Alle waren sie zu Unrecht denunziert und dazu gezwungen worden zu beweisen, daß sie nicht zur verfluchten Rasse gehörten. Eine seltsame Zeit, in der man aufgefordert wurde zu beweisen, was man nicht war, und nicht, was man war. Unter diesem Aspekt erinnerte das Frankreich Marschall Pétains an das Spanien der Inquisition, das die Reinheit des Blutes gefordert hatte. Dort war jeder verdächtigt worden."